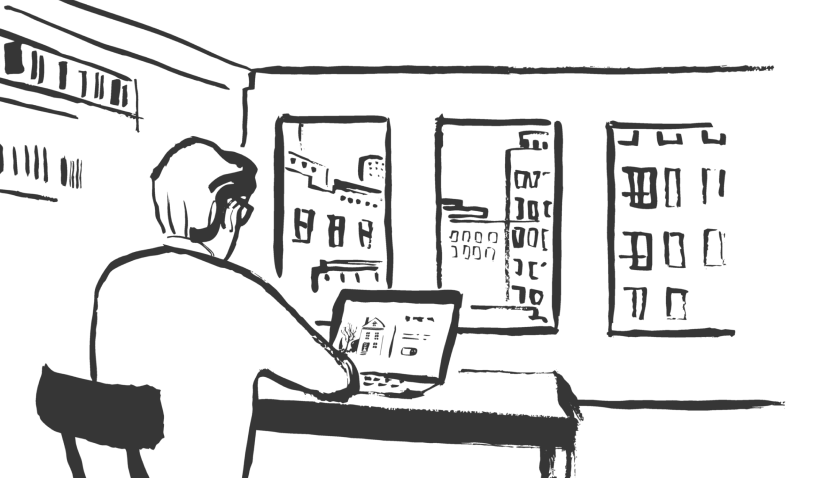Das Wichtigste in Kürze
- viele Gemeinschaftsflächen sind mitvermietet und bedürfen keiner weiteren Absprachen bezüglich der Nutzung
- das Mietrecht kennt kein Gewohnheitsrecht, deshalb können Vermieterinnen und Vermieter auch langjährige Nutzung von Flächen widerrufen
- stillschweigende Duldung der Nutzung von Garten, Keller oder Flurflächen müssen Mieterinnen und Mieter nachweisen
- ignorieren Mieterinnen und Mieter den Widerruf einer Nutzung, kann das eine Abmahnung oder Kündigung zur Folge haben
Inhaltsverzeichnis
1. Das Wichtigste in Kürze
2. Gemeinschaftsflächen, die zum Gebrauch der Wohnung gehören
3. Nutzung durch Mietvertrag oder Hausordnung regeln
4. Gewohnheitsrecht gibt es nicht
5. Stillschweigende Duldung der Nutzung
6. Abmahnung oder Kündigung bei Verstößen
7. FAQ – Häufig gestellte Fragen
In einem Mietshaus gibt es zahlreiche Flächen, die von allen Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam genutzt werden können. Dazu gehören das Treppenhaus, der Hof, der Garten, eventuell auch Flächen im Keller oder auf dem Dachboden. Über deren Nutzung besteht oft Unklarheit. Dürfen Mieterinnen und Mieter im Treppenhaus den Kinderwagen oder ihre Fahrräder abstellen? Wer darf auf dem Dachboden die Wäsche trocknen? Ist es erlaubt, im Garten den Liegestuhl und Grill aufzustellen oder Beete anzulegen? Oft kommt es zum Streit über die Nutzung der Gemeinschaftsflächen, nicht nur mit Vermieterinnen und Vermietern, sondern auch der Mieterinnen und Mieter untereinander.
Gemeinschaftsflächen, die zum Gebrauch der Wohnung gehören
Grundsätzlich gehören in einem Mehrfamilienhaus einige Gemeinschaftsflächen zum Gebrauch der Wohnung hinzu und gelten deshalb als mietgemietet, zum Beispiel das Treppenhaus, die Flure oder die Hofflächen. Deshalb dürfen im Hof die Kinder spielen (V ZR 46/06, Urteil vom 10. November 2006), ebenso dürfen Mieterinnen und Mieter dort den Teppich ausklopfen oder den Wagen zum Be- und Entladen abstellen. Auch dürfen Hausflure zum Abstellen von Kinderwagen oder eines Rollstuhls genutzt werden. Pauschale Klauseln in der Hausordnung, die dies generell verbieten, sind oft nicht zulässig, da sie den vertragsgemäßen Gebrauch unverhältnismäßig einschränken (LG Hamburg, Urteil v. 6. August 1991, Az 316 S 10/91, AG Hanau Urteil v. 19. Januar 1989, Az 34 C 1155/88).
Vielfach ist die Nutzung der Flure nur im Einzelfall zu beurteilen. So gibt es Urteile, die das dauerhafte Abstellen von Schuhen im Flur aus Brandschutzgründen untersagen. Gerichte haben aber ebenso geurteilt, dass bei Regen und Schnee die nassen Latschen draußen im Flur stehen bleiben dürfen.
Nutzung durch Mietvertrag oder Hausordnung regeln
Geht die Nutzung der Gemeinschaftsflächen wie Garten oder Keller über die allgemeine Nutzung hinaus, dann sollte das mit Mieterinnen und Mietern vereinbart werden. Das können Vermieterinnen und Vermieter über den Mietvertrag, die Hausordnung oder eine Nebenvereinbarung erledigen. So kann die Hausordnung die allgemeine Nutzung des Gartens erlauben. Der Mietvertrag kann die Sondernutzung an Kellerräumen oder zu Stellplätzen beinhalten.
Auch wenn die Nutzung der Flächen über die Hausordnung oder den Mietvertrag geregelt ist, ist das kein Freibrief für alles und jeden. Bauliche Veränderungen, Beschädigungen oder Ruhestörungen stellen Verletzungen der mietvertraglichen Pflichten dar und können eine Abmahnung oder sogar eine Kündigung zur Folge haben.

Tipp
Tipp
Häufig gibt es mündliche Absprachen zur Nutzung des Gartens, offen zugänglichen Kellerräumen oder anderen Gemeinschaftsflächen. Diese sind aber ungeeignet, um Klarheit zu schaffen. Damit das Mietverhältnis nicht unnötig belastet wird, solltest du deshalb alle Nutzungsvereinbarungen schriftlich festhalten – entweder im Mietvertrag, in der Hausordnung oder einer Nebenvereinbarung.
Gewohnheitsrecht gibt es nicht
Vielfach nutzen Mieterinnen und Mieter Gemeinschaftsflächen für ihre Zwecke, ohne dass dazu eine Erlaubnis oder Vereinbarung besteht. So stellen Bewohnerinnen und Bewohner ihr Fahrrad dauerhaft im Hausflur ab oder sitzen im Sommer zum Grillen draußen im Garten. Ist dazu keine Erlaubnis im Mietvertrag oder der Hausordnung vereinbart, dann können Vermieterinnen und Vermieter dies den Mieterinnen und Mietern untersagen. Das gilt auch dann, wenn Mieterinnen und Mieter ihr Auto bereits seit mehreren Jahren im Hof einfach abstellen. Das Mietrecht kennt grundsätzlich kein Gewohnheitsrecht. Die Gerichte werten auch eine jahrelange Nutzung einer Gemeinschaftsfläche als „Leihe“ oder Gefälligkeit seitens der Vermieterinnen und Vermieter.
Können Mieterinnen und Mieter die Mitvermietung einer Gemeinschaftsfläche nicht beweisen, dann können Vermieterinnen und Vermieter auch nach deren dauerhaften Nutzung diese ohne Verzug untersagen. Haben Mieterinnen und Mieter die Angewohnheit, ihr Auto im Hof abzustellen, können Vermieterinnen und Vermieter das verbieten – auch wenn sich Mieterinnen und Mieter schon jahrelang den Parkplatz angeeignet haben.
Stillschweigende Duldung der Nutzung
Die Rechtsprechung bietet bei der Nutzung der Gemeinschaftsflächen einen gewissen Interpretationsspielraum, weshalb im Einzelfall unbedingt Juristinnen und Juristen zu Rate zu ziehen sind. Denn neben dem Gewohnheitsrecht berufen sich Juristinnen und Juristen ebenso auf die „stillschweigenden Duldung“. Die präzise Abgrenzung dieser beiden Fälle ist nicht leicht zu verstehen und kann schnell in Haarspalterei ausarten. So sprechen die Gerichte von einer stillschweigenden Vereinbarung oder Duldung, wenn zum Beispiel Vermieterinnen und Vermieter von der Beschlagnahmung des Parkplatzes im Hof Kenntnis hatten. Auch können andere Mieterinnen und Mieter die Vermieterinnen und Vermieter auf die Parkpiraten hingewiesen haben. Unternehmen Vermieterinnen und Vermieter nichts, dann gilt das als „stillschweigende Vereinbarung“.
Noch eindeutiger ist der Fall, wenn Vermieterinnen und Vermieter den Mieterinnen und Mietern für die Nutzung einer Kellerfläche einen Schlüssel ausgehändigt haben. Auch damit wäre der Beleg erbracht, dass die Nutzung stillschweigend geduldet ist. Möchten Vermieterinnen und Vermieter die Nutzung der Kellerfläche wieder zurücknehmen, ist das leider nicht mehr ganz so einfach.
Das Oberlandesgericht Köln hat auch die Nutzung des Gartens bei einem Einfamilienhaus als Regelfall gewertet. So können auch hier Vermieterinnen und Vermieter die Gartennutzung nicht nachträglich verbieten (OLG Köln, Urteil vom 05.11.1993, Az.: 19 U 132/93).
Abmahnung oder Kündigung bei Verstößen
Bei der Nutzung von Gemeinschaftsflächen durch die Mieterinnen und Mieter ist Fingerspitzengefühl gefragt. Sitzen Mieterinnen und Mieter an einem schönen Sommerabend im Garten, muss man nicht gleich Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bemühen. Kommt es dabei zur Ruhestörung oder Vermüllung des Gartens, können Vermieterinnen und Vermieter von ihrem Recht Gebrauch machen, das zu verbieten. Auch beim Abstellen der Fahrräder sollte man Augenmaß bewahren. Ist dadurch der Brandschutz und der Zugang der Feuerwehr nicht mehr gewährleistet, haben Vermieterinnen und Vermieter das Recht und die Pflicht einzuschreiten. Wird die Nutzung trotz eines Widerrufs von den Mieterinnen und Mietern weiter fortgeführt, dann ist das ein vertragswidriges Verhalten. Das rechtfertigt eine Abmahnung und in letzter Konsequenz auch die Kündigung.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Das kommt auf den Einzelfall an. Grundsätzlich gehört das Treppenhaus zur Mietsache und darf entsprechend genutzt werden. Allerdings muss der Brandschutz gewährleistet bleiben und Fluchtwege dürfen nicht blockiert werden. Bei einzelnen Fahrrädern ist die Nutzung meist erlaubt, bei größeren Ansammlungen können Vermieterinnen und Vermieter dies untersagen.
Wenn die Gartennutzung nicht im Mietvertrag oder der Hausordnung geregelt ist, können Vermieterinnen und Vermieter diese grundsätzlich untersagen – auch nach jahrelanger Nutzung. Eine Ausnahme bildet die stillschweigende Duldung, die Mieterinnen und Mieter aber beweisen müssen. Bei Einfamilienhäusern gilt die Gartennutzung oft als selbstverständlich.
Ignorieren Mieterinnen und Mieter das Verbot der Nutzung von Gemeinschaftsflächen, stellt dies einen Verstoß gegen den Mietvertrag dar. Vermieterinnen und Vermieter können zunächst eine Abmahnung aussprechen. Bei wiederholten Verstößen ist auch eine Kündigung möglich.
Rechtlich sind auch mündliche Vereinbarungen bindend. Allerdings ist eine schriftliche Fixierung im Mietvertrag, der Hausordnung oder einer Nebenvereinbarung zu empfehlen, um späteren Streit zu vermeiden und Klarheit zu schaffen.
Pauschale Verbote in der Hausordnung sind oft unwirksam, wenn sie den vertragsgemäßen Gebrauch unverhältnismäßig einschränken. So dürfen Kinderwagen oder Rollstühle nicht generell aus den Hausfluren verbannt werden. Die Regelungen müssen verhältnismäßig und sachlich begründet sein.
Bei größeren Wohnanlagen mit Gemeinschaftsgärten sollten die Nutzungsrechte und -pflichten klar geregelt sein. Oft gibt es Gartenordnungen, die bestimmen, wer welche Bereiche wie nutzen darf. Ohne entsprechende Vereinbarung können Vermieterinnen und Vermieter die Nutzung einschränken oder untersagen.
Redaktionsrichtlinien von Vermietet.de
Die Vermietet.de Redaktion verfasst jeden Beitrag mit größter Sorgfalt und bezieht dabei ausschließlich seriöse Quellen und Gesetzestexte ein. Unsere Redakteur:innen sind selbst erfahrene Vermieter:innen oder haben sich in vielen Jahren ein hohes Niveau an Immobilienwissen angeeignet. Unsere Inhalte werden kontinuierlich überarbeitet und so leserfreundlich und verständnisvoll wie möglich für dich aufbereitet. Unser Ziel ist es, dich mit vertrauenswürdigen Inhalten zu informieren und dir eine erste Orientierung zu vielen Fragestellungen rund um die Themen Immobilien und Verwaltung zu bieten. Für persönliche Anfragen deiner rechtlichen oder finanziellen Anliegen, ziehe bitte eine:n Rechts-, Steuer-, oder Finanzberater:in hinzu.